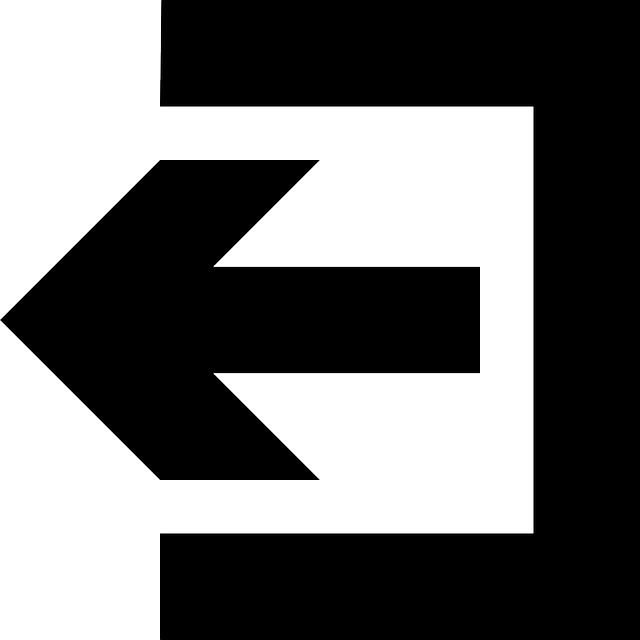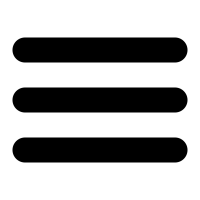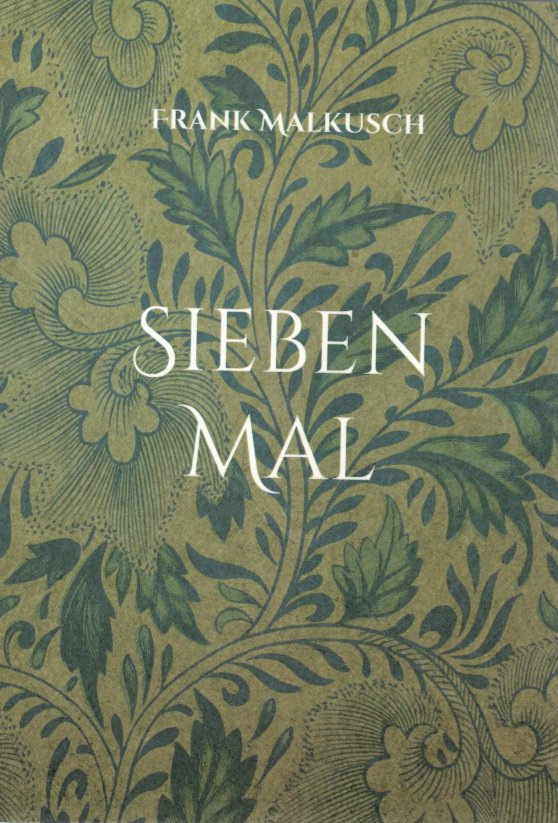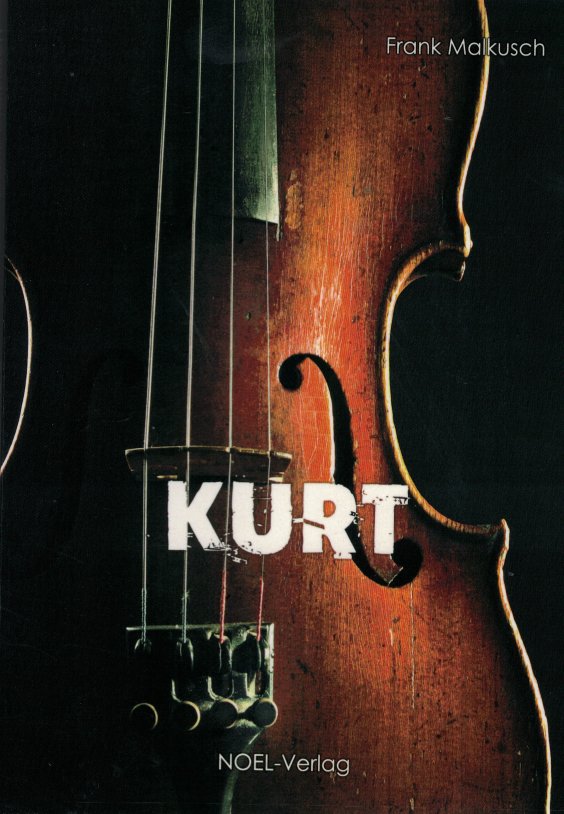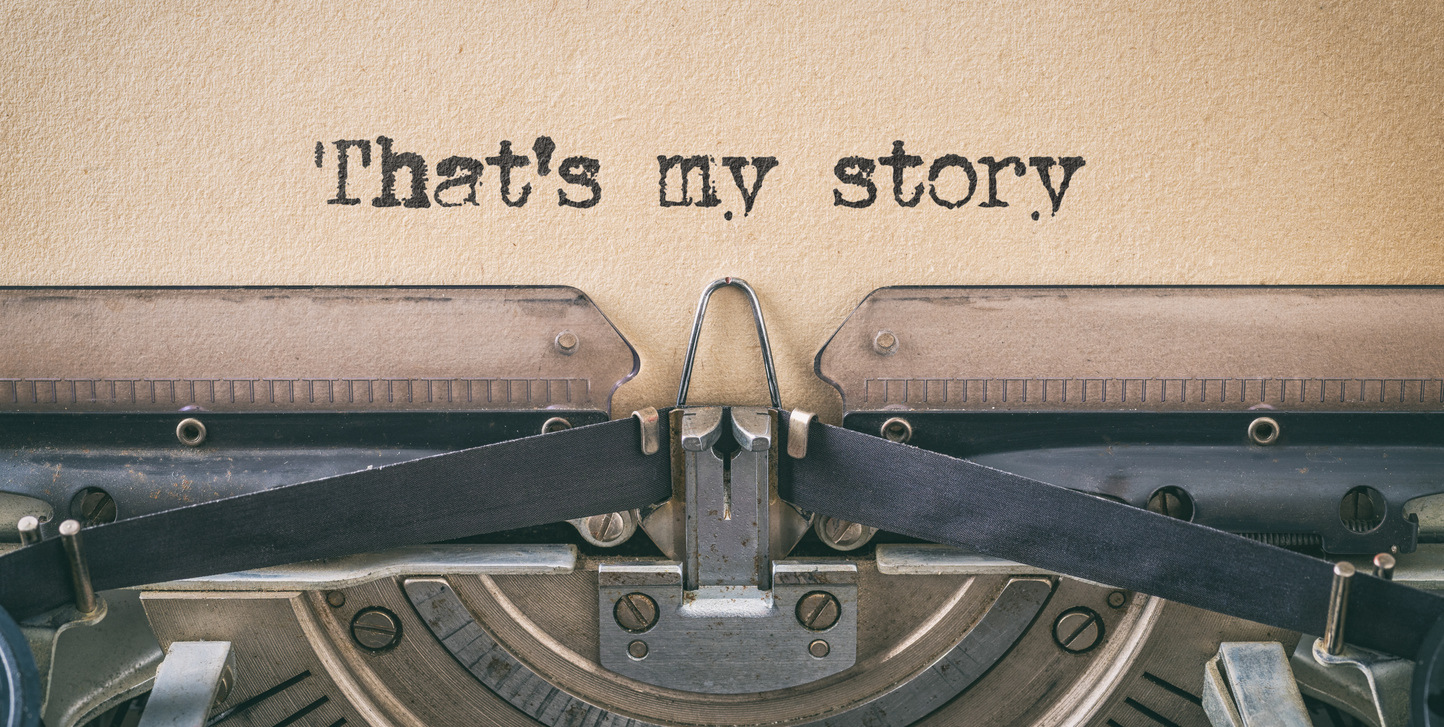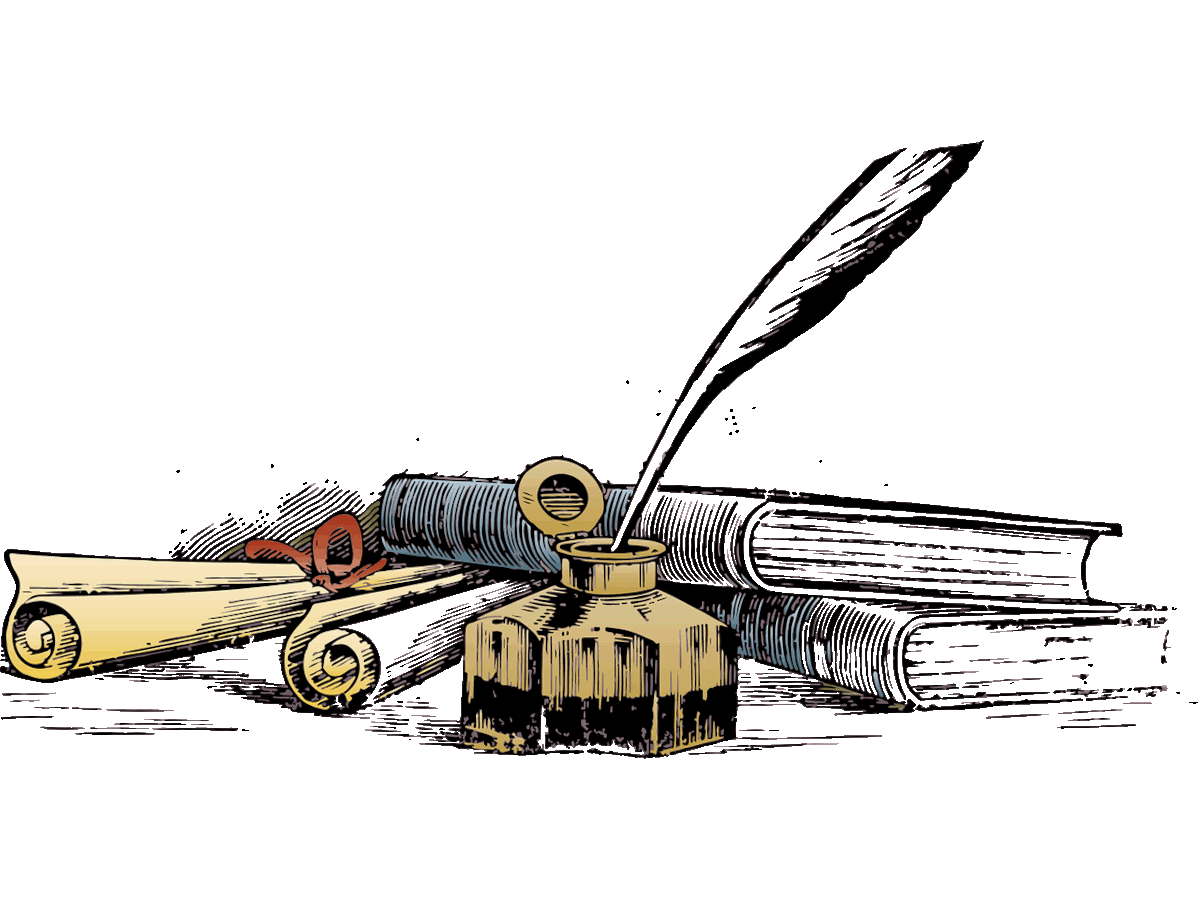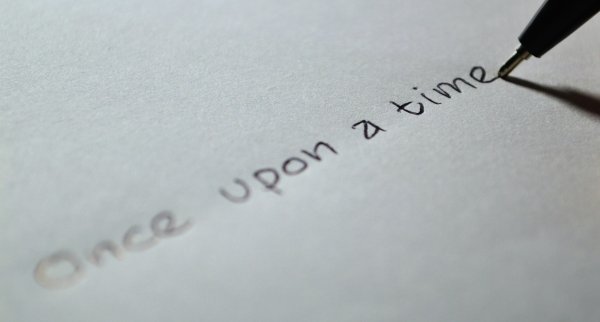Das Lehrbuch für Tiermedizinische Fachangestellte
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte des Berufes
1.1 Gehilfen
1.2 Veterinärgehilfen
1.3 Tierarzthelfer(in)
1.4 Tiermedizinische(r) Fachangestellte(r)
2 Ausbildung
2.1 Voraussetzungen
2.1.1 Schulische Voraussetzungen
2.1.2 Körperliche Voraussetzungen
2.1.3 Charakterliche und seelische Voraussetzungen
2.2 Ausbildungsstätten
2.2.1 Tierarztpraxis und Tierklinik
2.2.2 Berufsschule
2.3 Verlauf der Ausbildung
2.3.1 Ausbildungsvertrag
2.3.2 Dauer der Ausbildung
2.3.3 Probezeit
2.3.4 Kündigung während der Ausbildungszeit
2.3.5 Ausbildungszeit
2.3.6 Urlaub
2.3.7 Vergütung und sonstige Leistungen
2.3.8 Prüfungen
2.3.9 Zeugnis und Zwischenzeugnis
2.3.10 Jugendarbeitsschutzgesetz
2.4 Inhalte der Ausbildung
2.4.1 Ausbildungsberufsbild, Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsplan
2.4.2 Schriftlicher Ausbildungsnachweis
2.5 Grundpflichten der Auszubildenden
2.5.1 Sorgfaltspflicht
2.5.2 Weisungsgebundenheit
2.5.3 Schweigepflicht
3 Der Ausbildungsbetrieb
3.1 Das Gesundheitswesen
3.1.1 Berufe im Gesundheitswesen
3.1.2 Gesundheitsämter
3.2 Der Tierarzt/die Tierärztin
3.2.1 Ausbildung eines Tierarztes/einer Tierärztin
3.2.2 Beruf und Berufung des Tierarztes/der Tierärztin
3.2.3 Tätigkeitsfelder des Tierarztes/der Tierärztin
3.2.3.1 Tierarztpraxis
3.2.3.2 Tierklinik
3.2.3.3 Konsilliarische Tätigkeit von Tierärzten
3.2.3.4 Veterinärwesen
3.2.3.5 Tierärzte in Forschung und Lehre
3.2.3.6 Tierärzte in der Industrie und Wirtschaft
3.3 Organisation des Tierärztlichen Berufsstandes
3.3.1 Landestierärztekammern und Bezirksverbände
3.3.2 Bundestierärztekammer
3.4 Interessen und Interessensvertretungen der Tiermedizinischen Fachangestellten
3.4.1 Verband medizinischer Fachberufe e.V.
3.4.1.1 Manteltarifvertrag
3.4.1.2 Gehaltstarifvertrag
3.4.1.3 Arbeitsvertrag
3.4.2 Lebenslanges Lernen und Fortbildung
3.5 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
3.5.1 Unfallverhütung
3.5.2 Schutz vor Infektionskrankheiten und anderen beruflich bedingten Erkrankungen
3.5.3 Brandschutz
3.5.4 Notruf bei akuten Unfällen und Ausbruch von Feuer
3.5.5 Berufsgenossenschaft
3.5.6 Gewerbeaufsichtsamt
3.6 Umweltschutz in der Praxis
3.7 Gesetzliche und vertragliche Regelungen der tiermedizinischen Versorgung
3.7.1 Rechtsvorschriften im Veterinärwesen
3.7.2 Schweigepflicht
3.7.3 Vertragsformen
3.7.3.1 Dienstvertrag und Werkvertrag
3.7.3.2 Betreuungsvertrag
3.7.3.3 Vereinbarung über Gebührensätze, die von der GOT abweichen
3.7.3.4 Aufklärung und Einwilligung des Patientenbesitzers
3.7.3.5 Tierhaltererklärung
3.8 Möglichkeiten und Grenzen selbständigen Handelns Tiermedizinischer Fachangestellter
3.8.1 Weisungsgebundenheit
3.8.2 Vollmachten
4 Hygiene und Infektionsschutz
4.1 Hygiene
4.1.1 Verhütende Maßnahmen
4.1.2 Sauberkeit
4.1.3 Abfallbeseitigung
4.1.3.1 Entsorgung von Tierkörpern
4.1.3.2 Lagerung des Tierkörpers bis zur Abholung
4.1.4 Desinfektion
4.1.4.1 Flächendesinfektion
4.1.4.2 Instrumenten- und Gerätedesinfektion
4.1.4.3 Hautdesinfektion
4.1.4.4 Händedesinfektion
4.1.4.5 Gefahren von Desinfektionsmitteln
4.1.5 Sterilisation
4.1.5.1 Heißluftsterilisation
4.1.5.2 Dampfsterilisation
4.1.4.3 Gassterilisation
4.1.5.4 Sterilisation mit Strahlen
4.1.6 Persönliche Hygiene
4.2 Infektions- und Seuchenschutz
4.2.1 Hygienekette
4.2.2 Infektionskrankheiten
4.2.2.1 Infektion
4.2.2.2 Infektionskrankheit
4.2.2.3 Seuche
4.2.2.4 Zoonosen
4.2.2.5 Infektionserreger
4.2.3 Anzeige- und Meldepflicht
4.2.3.1 Anzeigepflicht
4.2.3.2 Anzeigepflicht
4.2.4 Impfung
4.2.4.1 Aktive Impfung
4.2.4.2 Passive Impfung
4.2.4.3 Impfdokumentation
5 Tierschutz und Patientenbetreuung
5.1 Tierschutz
5.1.1 Tierschutzgesetz
5.1.2 Tierschutz im Grundgesetz
5.1.3 Tierhaltung
5.1.4 Töten von Tieren
5.1.5 Tierversuche
5.1.6 Diagnose und Therapie bei Tieren
5.2 Umgang mit Tieren
5.3 Handling von Tieren
5.3.1 Eigenschutz
5.3.2 Handgriffe zum Fixieren eines Tieres
5.3.2.1 Hund
5.3.2.2 Katze
5.3.2.3 Kaninchen und Meerschweinchen
5.3.2.4 Ratte, Maus, Hamster
5.3.2.5 Vögel
5.4 Versorgung stationärer Tiere
6 Kommunikation
6.1 Kommunikationsformen und Kommunikationsmethoden
6.1.1 Verbale und nonverbale Kommunikation
6.2 Kommunikationsebenen
6.2.1 Inhaltsebene
6.2.2 Prozessebene
6.2.3 Beziehungsebene
6.3 Regeln der verbalen Kommunikation
6.4 Aspekte der nonverbalen Kommunikation
6.4.1 Gestik
6.4.2 Mimik
6.4.3 Blickkontakt
6.4.4 Körperhaltung
6.4.5 Abstand halten
6.4.6 Körperkontakt
6.4.7 Kleidung
6.4.8 Kulturelle Unterschiede
6.5 Gesprächsführung
6.5.1 Klarheit schaffen
6.5.2 Zuhören
6.5.3 Ausreden lassen
6.5.4 Den richtigen Ton treffen
6.5.5 Ich-Botschaften verwenden
6.5.6 Die richtige Fragetechnik
6.5.7 Den Gesprächspartner dort „abholen“, wo er steht
6.6 Gesprächsarten
6.6.1 Teamgespräch
6.6.2 Einzelgespräch
6.6.3 Diskussion
6.7 Das Telefongespräch
6.8 Beratung und Betreuung von Tierhaltern
6.8.1 Tierhalter über das Leistungsspektrum der Praxis (Klinik) informieren
6.8.2 Tierhalter über Einzelleistungen beraten
6.8.3 Den Balanceakt zwischen Klientenerwartung und Praxisabläufen managen
6.8.4 Tierhalter zu einer Behandlung motivieren
6.8.5 Tierärztliche Beratungen und Anweisungen unterstützen
6.9 Verhalten in Konfliktsituationen
6.9.1 Konfliktarten
6.9.1 Persönliche Konflikte
6.9.2 Zwischenmenschliche Konflikte
6.9.3 Konflikte wegen unterschiedlicher Arbeitsweisen
6.9.4 Autoritätskonflikte
6.9.5 Verdeckte Konflikte
6.9.6 Offene Konflikte
6.9.7 Konfliktlösung
6.10 Mit Fehlern umgehen
6.11 Mit Kritik umgehen
6.12 Mobbing
7 Information und Datenschutz
7.1 Informations- und Kommunikationssysteme
7.2.1.Daten erfassen, pflegen und austauschen
7.3.2 Informationen beschaffen und nutzen
7.2 Datenschutz und Datensicherheit
7.2.1 Bundesdatenschutzgesetz
7.2.1.1 Datenschutzbeauftragter
7.2.2 Datensicherung
7.2.2.1 Sicherung elektronischer Daten
7.2.2.2 Interne Sicherungsmaßnahmen
8 Betriebsorganisation und Qualitätsmanagement
8.1 Marketing und Marketingziele
8.1.1 Kundenwerbung
8.1.2 Marketinginstrumente zur Kundenwerbung
8.1.3 Kundenbindung
8.1.4 Marketinginstrumente zur Kundenbindung
8.1.5 Strategien zur Umsatzsteigerung
8.1.6 Zu guter Letzt
8.2 Arbeiten im Team
8.3 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement
8.3.1 Qualität
8.3.2 Qualitätssicherung
8.3.3 Qualitätsmanagement
8.3.4 PDCA-Zyklus
8.3.5 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Praxisalltag
8.3.5.1 Einbindung der Tierarztpraxis in Qualitätsprogramme von Unternehmen
8.3.5.2 Fehler und Beschwerden
8.4 Zeitmanagement
8.4.1 Erstellen eines Zeitprotokolls
8.4.2 Analyse des Zeitprotokolls
8.4.3 Planen eines effektiven Zeitablaufs
8.4.4 Hilfsmittel für ein effektives Zeitmanagement
8.5 Stress
8.5.1 Entstehungsursachen für Distress
8.5.2 Strategien zur Vermeidung von Distress
9 Betriebsverwaltung und Abrechnung
9.1 Tierhalter und Patientendaten aufnehmen und verarbeiten
9.1.1 Stammdaten des Tierhalters
9.1.2 Stammdaten und Kennzeichen des Patienten
9.1.3 Interne Statistiken
9.1.4 Recallsystem
9.2 Posteingang und Postausgang bearbeiten
9.2.1 Posteingang sortieren
9.2.2 Praxispost bearbeiten
9.2.3 Postausgang
9.2.4 Versand medizinischer Proben
9.3 Schriftverkehr durchführen, Vordrucke und Formulare auswählen und bearbeiten
9.3.1 Textbaustein
9.3.2 DIN-Normen
9.4 Ablagesysteme und Archivierungsarbeiten
9.4.1 Aufbewahrungsfristen
9.4.2 Vernichtung von Unterlagen
9.5 Abrechnungswesen
9.5.1 Barzahlung
9.5.2 Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte
9.5.3 Zahlung durch Überweisung
9.5.4 Zahlung durch Bankeinzug
9.6 Mahnverfahren
9.6.1 Außergerichtliches Mahnverfahren
9.6.2 Gerichtliches Mahnverfahren
9.6.3 Verjährung
9.7 Rechnungen erstellen - Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)
9.7.1 Gebühren
9.7.2 Entschädigungen
9.7.3 Entgelte
9.7.4 Barauslagen
9.7.5 Mehrwertsteuer
9.7.6 Rechnungsstellung
9.8 Materialbeschaffung- und Verwaltung
9.8.1 Lagerhaltung
9.8.2 Bestellung von Waren, Verbrauchsmaterialien und Medikamenten
9.8.3 Kaufvertragsrecht
9.8.3.1 Abschluss eines Kaufvertrages
9.8.3.2 Stellvertretung
9.8.3.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen
9.9.3.4 Störungen des Kaufvertrages
9.9 Warenannahme
9.9.1 Überprüfung des Wareneingangs
9.9.2 Überprüfung des Lieferscheins und der Rechnung
9.9.3 Rückgabekonditionen
10 Tierärztliche Hausapotheke
10.1 Das Dispensierrecht
10.2 Indikation von Medikamenten
10.2.1 Medikamente zur Behandlung von Infektionskrankheiten (Antiinfektiva)
10.2.2 Medikamente zur Behandlung von Herzerkrankungen (Kardiaka)
10.2.3 Medikamente gegen Schmerzen (Analgetika, Anästhetika)
10.2.4 Medikamente gegen psychische Erregungszustände (Sedativa)
10.2.5 Medikamente gegen Krämpfe der glatten Muskulatur (Spasmolytika)
10.2.6 Medikamente gegen Krämpfe der gestreiften Muskulatur (Muskelrelaxantien)
10.2.7 Medikamente gegen epileptische Krampfanfälle (Antiepileptika, Antikonvulsiva)
10.2.8 Medikamente gegen Entzündungen (Antiphlogistika)
10.2.9 Medikamente gegen Allergien (Antiallergika)
10.2.10 Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen (Antiemetika)
10.2.11 Medikamente, die Erbrechen hervorrufen (Emetika)
10.2.12 Medikamente gegen Vergiftungen (Antidota)
10.2.13 Medikamente gegen Tumore (Zytostatika)
10.2.14 Medikamente gegen die Beschwerden des Alters (Geriatrika)
10.2.15 Hormone
10.2.16 Vitamine
10.2.17 Weitere Arzneimittel
10.2.17.1 Pflanzliche Arzneimittel
10.2.17.2 Homöopathische Mittel
10.3 Darreichungsformen von Arzneimitteln
10.3.1 Tablette
10.3.2 Kapsel
10.3.3 Pellets
10.3.4 Zäpfchen
10.3.5 Lösung
10.3.6 Suspension
10.3.7 Paste
10.3.8 Salbe
10.3.9 Transdermal wirksame Medikamente (spot-on-Medikamente)
10.3.10 Aerosol
10.3.11 Tinktur
10.3.12 Globuli
10.3.13 Dekokt
10.3.14 Aufguss
10.3.15 Subdermaler Chip
10.4 Applikationsarten
10.4.1 Perorale Applikation
10.4.2 Applikation durch Injektion
10.4.3 Applikation durch Infusion
10.5 Abgabe von Arzneimitteln
10.5.1 Verschreibungspflichtige Arzneimittel
10.5.2 Apothekenpflichtige Arzneimittel
10.5.3 Freiverkäufliche Arzneimittel
10.5.4 Betäubungsmittel
10.6 Herstellung von Arzneimitteln
10.6.1 Fertigarzneimittel
10.6.2 Rezepturarzneimittel
10.6.3 Fütterungsarzneimittel
10.6.4 Beipackzettel
10.6.5 Rezept
10.7 Die Aufgaben von Tiermedizinischen Fachangestellten in der Tierärztlichen Hausapotheke
10.7.1 Bestellung von Arzneimitteln
10.7.2 Kontrolle und Dokumentation der Medikamentenlieferung
10.7.2.1 Kontrolle und Reklamation
10.7.2.2 Dokumentation
10.7.3 Lagerung von Arzneimitteln
10.7.4 Betreuung der Tierärztlichen Hausapotheke
10.7.4.1 Einwandfreie Beschaffenheit der Arzneimittel
10.7.4.2 Vollständigkeit der Arzneimittel
10.7.5 Abgabe von Arzneimitteln
10.7.5.1 Vorschriften zur Abgabe von Arzneimitteln
10.7.5.2 Berechnung des Medikamenten-Abgabepreises
10.7.5.3 Arzneimittelpreislisten, Arzneimittelpreistabellen
11 Maßnahmen bei Diagnostik und Therapie unter Anleitung und Aufsicht des/der Tierarztes/Tierärztin
11.1 Assistenz bei tierärztlicher Diagnostik
11.1.1 Die medizinische Fachsprache
11.1.1.1 Vorsilben, Endungen und Schreibweisen
11.1.1.2 Lage und Richtungsbeschreibungen am Körper
11.1.1.3 Abkürzungen
11.1.1.4 Fachbegriffe
11.1.2 Der Untersuchungsgang
11.1.2.1 Daten des Tierhalters, Daten und Kennzeichen des Patienten
11.1.2.2 Anamnese
11.1.2.3 Allgemeiner Untersuchungsgang
11.1.2.4 Spezielle und weiterführende Untersuchungen
11.1.3 Vorbereitung, Assistenz und Dokumentation bei diagnostischen Maßnahmen
11.1.4 Aufgaben Tiermedizinischer Fachangestellter bei einigen ausgewählten Diagnostikmaßnahmen
11.1.4.1 Entnahme einer Gewebeprobe
11.1.4.2 Blutentnahme
11.1.4.3 Blutdruckmessung
11.1.4.4 Elektrokardiogramm (EKG)
11.1.4.5 Sonographie
11.2 Assistenz bei tierärztlicher Therapie
11.2.1 Narkose
11.2.1.1 Narkosearten
11.2.1.2 Narkoseüberwachung
11.2.2 Operationen und Behandlungen
11.2.2.1 Subcutane Injektion
11.2.2.2 Aufziehen eines Medikamentes
11.2.2.3 Infusion
11.2.3 Bezeichnung und Funktion wichtiger tiermedizinischer (veterinärmedizinischer) Instrumente
11.2.3.1 Pinzetten
11.2.3.2 Skalpell
11.2.3.3 Scheren
11.2.3.4 Klemmen
11.2.3.5 Zangen
11.2.3.6 Wundhaken
11.2.3.7 Wundspreizer
11.2.3.8 Küretten und scharfe Löffel
11.2.3.9 Chirurgische Nadeln
11.2.3.10 Nadelhalter
11.2.3.11 Unterbindungsnadeln
11.2.3.12 Perkussionshammer
11.2.3.13 Spekula
11.2.3.14 Backenspreizer
11.2.3.15 Maulspreizer, Maulgatter
11.2.3.16 Wurzelheber
11.2.3.17 Zahnextraktionszange
11.2.3.18 Kastrationszange
11.2.4 Chirurgisches Nahtmaterial
11.2.4.1 Anforderungen an chirurgisches Nahtmaterial
11.2.5 Verbandsmaterial und Verbandstechniken
11.2.5.1 Verband
11.2.5.2 Verbandsmaterial
11.2.5.3 Verbandstechniken
11.2.5.4 Grundsätze beim Anlegen und Tragen von Verbänden
11.2.6 Hausbesuchsausrüstung kontrollieren und fallspezifisch zusammenstellen
11.2.7 Pflege von Diagnose- und Therapiegeräten
11.2.7.1 Grundsätzliches zur Reinigung
12 Prävention und Rehabilitation
12.1 Maßnahmen zur Prävention
12.1.1 Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten
12.1.2 Gesunderhaltung durch artgerechte Fütterung, artgerechte Haltung, Körperpflege und Früherkennungsmaßnahmen
12.1.3 Ernährung
12.1.3.1 Grundlagen der Ernährung
12.1.3.2 Bestandteile der Nahrung
12.1.3.3 Ernährung verschiedener Tierarten
12.1.3.3.1 Hund
12.1.3.3.2 Katze
12.1.3.3.3 Meerschweinchen und Kaninchen
12.1.3.3.4 Chinchilla
12.1.3.3.5 Ratte
12.1.3.3.6 Maus
12.1.3.3.7 Hamster
12.1.3.3.8 Vögel
12.1.3.3.9 Frettchen
12.1.4 Verhalten und artgerechte Haltung von Heimtieren, kleinen Säugern, Vögeln und Frettchen
12.1.4.1 Kaninchen
12.1.4.2 Meerschweinchen
12.1.4.3 Chinchilla
12.1.4.4 Hamster
12.1.4.5 Ratte
12.1.4.6 Maus
12.1.4.7 Frettchen
12.1.4.8 Vögel
12.1.5 Körperpflege
12.1.5.1 Zahnpflege, Zahnsteinprophylaxe
12.1.5.2 Fell- und Gefiederpflege
12.1.5.3 Gewichtskontrolle
12.1.5.4 Ohren
12.1.5.5 Krallenpflege
12.1.5.6 Hufbeschlag
12.1.6 Klauenpflege
12.1.7 Verhindern und Erkennen von Verhaltensstörungen
12.2 Früherkennungsmaßnahmen
12.3 Maßnahmen zur Rehabilitation
12.3.1 Physiotherapie
12.3.2 Akupunktur
12.3.3 Magnetfeldtherapie
13 Laboruntersuchungen
13.1 Einsendung von Untersuchungsmaterial an das Labor
13.2 Dokumentation
13.3 Kotuntersuchungen
13.3.1 Direktkotuntersuchung
13.3.1.1 Durchführung der Direktkotuntersuchung
13.3.2 Flotationsverfahren
13.3.2.1 Durchführung des Flotationsverfahrens
13.3.3 Sedimentationsverfahren
13.3.3.1 Durchführung des Sedimentationsverfahrens
13.3.4 Auswanderungsverfahren
13.3.5 Teststreifen
13.3.5 Schnelltestverfahren
13.3.5.1 Giardienschnelltest
13.3.5.2 Parvoviroseschnelltest
13.4 Urinuntersuchung
13.4.1 Uringewinnung
13.4.2 Urinuntersuchung
13.4.3 Beurteilung des Urins
13.4.3.1 Volumen
13.4.3.2 Farbe
13.4.3.3 Durchsichtigkeit
13.4.3.4 Geruch
13.4.3.5 Spezifisches Gewicht
13.4.3.6 Teststreifen
13.4.4 Harnsediment
13.4.4.1 Bewertung des Harnsedimentes
13.5 Untersuchung der Haut
13.5.1 Tesafilm-Abklatschpräparat
13.5.2 Flohkammmethode
13.5.3 Haarprobe
13.5.4 Hautgeschabsel
13.5.5 Federprobe
13.6 Blutuntersuchung
13.6.1 Verarbeitung einer Blutprobe
13.6.1.1 Ungerinnbar gemachtes Blut
13.6.1.2 Blutserum
13.6.1.3 Blutplasma
13.6.1.4 Blutausstrich
13.7 Untersuchungsmethoden Blut
13.7.1 Blutbild
13.7.2 Differentialblutbild
13.7.3 Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit
13.7.4 Blutgasanalyse
13.7.5 Schnelltestverfahren mit Blut
13.7.5.1 Blutzuckerbestimmung
13.7.5.2 Snap-Test-Verfahren
13.8 Bakteriologische Untersuchung
13.9 Mykologische Untersuchung
13.10 Parasitologische Untersuchung
13.11 Mikroskop
14 Röntgen und Strahlenschutz
14.1 Strahlenbelastung
14.1.1 Strahlenquellen
14.1.1.1 Strahlenbelastung durch natürliche Strahlenquellen
14.1.1.2 Strahlenbelastung durch künstliche Strahlenquellen
14.2 Radionuklide
14.3 Halbwertszeit
14.3.1 Physikalische Halbwertszeit
14.3.2 Biologische Halbwertszeit
14.3.3 Effektive Halbwertszeit
14.4 Strahlenschäden
14.4.1 Strahlenschäden auf Zellebene
14.4.1.1 Determinierte Strahlenschäden
14.4.1.2 Stochastische Strahlenschäden
14.4.2 Strahlenschäden auf Körperebene
14.4.3 Besondere Empfindlichkeit bestimmter Körpergewebe
14.5 Dosisbegriffe und Maßeinheiten
14.6 Röntgen
14.6.1 Erzeugung von Röntgenstrahlen
14.6.2 Das Grundprinzip der Röntgendiagnostik
14.6.3 Röntgenstrahl
14.6.4 Röntgenapparat
14.6.4.1 Kontrolle des Röntgenapparates und der Fachkunde
14.6.5 Röntgenkassette
14.6.6 Röntgenfilm
14.6.6.1 Zahnfilm
14.6.7 Röntgenfilmbearbeitung
14.6.7.1 Dunkelkammer
14.6.7.2 Röntgenfilmbeschriftung
14.6.7.3 Röntgenfilmentwicklung
14.6.7.4 Qualitätssicherung beim Röntgen und der Röntgenfilmentwicklung
14.6.8 Digitales Röntgen
14.6.8.1 Vorteile des digitalen Röntgens
14.6.8.2 Nachteile des digitalen Röntgens
14.6.9 Beschreibung der Röntgenuntersuchung
14.6.9.1 Beschreibung (Nomenklatur) verschiedener Strahlengänge durch den Patienten
14.6.9.2 Weitere Beschreibungen (Nomenklatur)
14.6.10 Lagerungshilfen
14.7 Dokumentation
14.8 Weitere bildgebende Verfahren mit radioaktiver Strahlung
14.8.1 Computertomographie
14.8.2 Szintigraphie
14.9 Bildgebende Verfahren ohne radioaktive Strahlung
14.9.1 MRT
14.9.2 Ultraschalluntersuchung
14.10 Strahlenschutzmaßnahmen
14.10.1 Strahlenschutz
14.10.2 Probleme des Strahlenschutzes in der Tiermedizin
14.10.3 Gesetzliche Regelungen
14.10.4 Kenntnisse in Strahlenschutz
14.10.5 Strahlenmessung
14.10.5.1.Filmdosimeter
14.10.5.2.Ringdosimeter
14.10.5.3 Stabdosimeter
14.10.6 Strahlenschutzbereiche
14.10.7 Schutzkleidung
14.10.8 Abstand halten
14.10.9 Einblenden
14.10.10 Lagerungshilfen verwenden
14.10.11 Qualitätssicherung
14.10.12 Strahlenschutz bei der Szintigraphie
14.10.13 Strahlenschutz bei der Computertomographie
15 Notfallmanagement
15.1 Erste Hilfe beim Menschen
15.1.1 Kreislaufschwäche
15.1.2 Biss- und Kratzwunden
15.1.3 Stark blutende Wunden
15.1.3.1 Schocklagerung
15.1.4 Verbrennung
15.1.5 Verätzung
15.1.6 Bewusstlosigkeit
15.1.6.1 Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit
15.1.6.1.1 Stabile Seitenlage
15.1.6.1.2 Stabile Seitenlage bei einer Schwangeren
15.1.6.1.3 Herz-Lungen-Wiederbelebung
15.1.7 Notfallnummer
15.1.8 Verbandsbuch
15.1.9 Meldepflicht
15.1.10 Durchgangsarzt
15.1.11 Verbandskasten
15.1.12 Aushang Erste Hilfe - Notfallplan
15.2 Hilfeleistung bei Notfällen am Tier
15.2.1 Notfallausrüstung warten
15.2.2 Notfälle erkennen
15.2.3 Erstversorgung durchführen
15.2.3.1 Ruhe bewahren
15.2.3.2 Selbstschutz
15.2.3.3 Vitalfunktionen
15.2.3.4 Schock
15.2.3.5 Blutungen
15.2.3.6 Hitzschlag
15.2.3.7 Verbrennung
15.2.3.8 Augennotfälle
15.2.3.9 Magendrehung
15.2.3.10 Bissverletzungen
15.2.3.11 Offene Bauchhöhle
15.2.3.12 Milchfieber
15.2.3.13 Kolik
15.2.3.14 Akute Atemnot
15.2.3.15 Atemstillstand
15.2.3.16 Stromschlag
15.2.3.17 Epilepsie
15.2.3.18 Notfälle bei Vögeln
15.2.4 Komplikationen bei operativen Eingriffen erkennen
15.2.4.1 Narkoseüberwachung
15.2.4.2 Narkosezwischenfälle rechtzeitig erkennen
15.2.4.3 Nachschlafphase
15.2.4.4 Dokumentation
Medizinischer Teil
1 Die Zelle
1.1 Zellarten
1.2 Aufbau der Zelle
1.2.1 Zellmembran
1.2.2 Zellplasma
1.2.3 Zellorganellen
1.2.4 Zellkern
1.2.5 DNS bzw DNA
1.2.6 Gen
1.2.7 RNS bzw RNA
1.3 Zellteilung
1.3.1 Mitose
1.3.2 Meiose
1.4 Zelltod
1.5 Mutation
1.6 Tumorzelle
1.7 Zellen und Zellbestandteile in Forschung und Technik
1.7.1 Zellkulturen
1.7.2 PCR – Verfahren
1.7.3 Geschlechtsbestimmung bei Vögeln
1.7.4 Genetischer Fingerabdruck
1.7.5 Abstammungsnachweis
1.8 Fachbegriffe zum Thema Zelle
2 Gewebelehre
2.1 Gewebearten
2.1.1 Epithelgewebe
2.1.1.1 Deckepithel
2.1.1.2 Einschichtiges Plattenepithel
2.1.1.3 Einschichtiges kubisches Epithel
2.1.1.4 Einschichtiges Zylinderepithel
2.1.1.5 Mehrschichtiges Flimmerepithel
2.1.1.6 Mehrstufiges Plattenepithel
2.1.1.7 Übergangsepithel
2.1.1.8 Drüsenepithel
2.1.1.9 Sinnesepithel
2.1.2 Binde- und Stützgewebe
2.1.2.1 Bindegewebe
2.1.2.2 Knorpelgewebe
2.1.2.3 Knochengewebe
2.1.3 Muskelgewebe
2.1.3.1 Quer gestreiftes Muskelgewebe
2.1.3.2 Glattes Muskelgewebe
2.1.3.3 Herzmuskelgewebe
2.1.4 Nervengewebe
2.1.4.1 Nervenzellen
2.1.4.2 Gliazellen
2.1.4.3 Nervenfasern
2.1.4.4 Nerv
2.2 Fachbegriffe zum Thema Gewebelehre
3 Stütz- und Bewegungsapparat
3.1 Stützapparat
3.1.1 Knochen
3.1.1.1 Grundbau eines Knochens
3.1.1.2 Einteilung der Knochen nach ihrer Struktur und äußeren Form
3.1.1.3 Einteilung der Knochen nach ihrer Lage im Körper
3.1.2 Gelenk
3.1.2.1 Aufbau eines Gelenkes
3.1.2.2 Einteilung der Gelenke
3.1.3 Gelenkknorpel
3.1.4 Sesambein
3.1.5 Bandscheibe
3.1.6 Bänder
3.2 Bewegungsapparat
3.2.1 Skelettmuskeln
3.2.2 Faszie
3.2.3 Sehnen
3.2.4 Sehnenscheiden
3.2.5 Schleimbeutel
3.3 Untersuchungsmethoden
3.3.1 Körperliche Untersuchung
3.3.2 Röntgen
3.3.3 Ultraschall
3.3.4 Kernspintomographie (Magnetresonanztomographie, MRT)
3.3.4 Computertomographie (CT)
3.4 Fachbegriffe zum Thema Bewegungs- und Stützapparat
4 Herz
4.1 Lage des Herzens im Körper
4.2 Herzbeutel
4.3 Innenräume des Herzens
4.4 Aufbau der Herzwand
4.5 Herzskelett
4.6 Herzklappen
4.6.1 Segelklappen
4.6.2 Taschenklappen
4.7 Blutgefäße des Herzens
4.7.1 Funktionelle Blutgefäße
4.8 Ernährung des Herzens
4.9 Arbeitsweise des Herzens
4.10 Der Weg des Blutes durch das Herz
4.11 Herzschlag und Puls
4.12 Herztöne
4.13 Steuerung der Herzaktivität
4.13.1 Autonome Steuerung
4.13.2 Nervale Steuerung
4.13.3 Hormonelle Steuerung
4.14 Untersuchungsmethoden
4.14.1 Auskultation
4.14.2 EKG
4.14.3 Herzultraschall
4.14.4 Blutuntersuchung
4.14.4.1 Nt-pro BNP-Nachweis
4.14.4.2 Weitere Blutuntersuchungen
4.15 Fachbegriffe zum Thema Herz
5 Kreislauf und Gefäße
5.1 Herz
5.2 Blutgefäße
5.2.1 Einteilung der Blutgefäße
5.2.2 Bau der Blutgefäße
5.2.2.1 Aufbau der Arterienwand
5.2.2.2 Aufbau der Venenwand
5.3 Kreislaufsysteme
5.3.1 Körperkreislauf
5.3.2 Lungenkreislauf
5.3.3 Pfortaderkreislauf
5.3.4 Fetaler Kreislauf
5.4 Untersuchungsmethoden
5.4.1 Kapillarfüllungszeit
5.4.2 Pulsmessung
5.4.3 Untersuchung des Herzens
5.4.4 Ultraschall-Doppler-Untersuchung
5.4.5 Computertomographie
5.4.6 Magnetresonanztomographie
5.4.7 Angiographie
5.5 Fachbegriffe zum Thema Kreislauf und Gefäße
6 Blut
6.1 Zusammensetzung des Blutes
6.1.1 Blutplasma
6.1.1.1 Fibrinogen
6.1.1.2 Bluteiweiße
6.1.1.3 Elektrolyte
6.1.1.4 Nährstoffe
6.1.1.5 Aufbaustoffe
6.1.1.6 Hormone und Enzyme
6.1.2 Blutzellen
6.1.2.1 Bildung der Blutzellen
6.1.2.2 Rote Blutkörperchen
6.1.2.3 Weiße Blutkörperchen
6.1.2.4 Blutplättchen
6.2 Physikalische Eigenschaften des Blutes
6.3 Aufgaben des Blutes
6.4 Blutgruppen
6.5 Blutstillung und Blutgerinnung
6.6 Untersuchungsmethoden
6.6.1 Blutbild
6.6.1.1 Kleines Blutbild
6.6.1.1.1 Leukozyten
6.6.1.1.2 Erythrozyten
6.6.1.1.3 Retikulozyten
6.6.1.1.4 Thrombozyten
6.6.1.1.5 Hämoglobin (Roter Blutfarbstoff)
6.6.1.1.6 MCH (mittlerer korpuskulärer Hämoglobinanteil)
6.6.1.1.7 MCV (mittleres korpuskuläres Volumen)
6.6.1.1.8 MCHC (mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration)
6.6.1.1.9 Hämatokrit (Hkt)
6.6.2 Differentialblutbild
6.6.3 Nachweis von Blutgerinnungstörungen
6.6.3.1 Quick-Test (Thromboplastinzeit, TPZ, Prothrombinzeit)
6.6.3.2 Partielle Thromboplastinzeit (PTT)
6.6.3.3 Thrombinzeit (TZ)
6.6.4 Untersuchung der Blutflüssigkeit
6.6.5 Blutkultur
6.7 Fachbegriffe zum Thema Blut
7 Das lymphatische System
7.1 Lymphatische Organe
7.1.1 Schleimhautassoziiertes lymphatisches Gewebe
7.1.2 Milz
7.1.3 Thymus
7.1.4 Lymphknoten
7.1.5 Bursa fabricii
7.2 Lymphgefäße
7.3 Lymphflüssigkeit
7.4 Untersuchungsmethoden
7.4.1 Körperliche Untersuchung
7.4.2 Gewebeprobe
7.4.3 Punktion
7.4.4 Blutuntersuchung
7.4.5 Röntgen und Ultraschall
7.4.6 Magnetresonanztomographie und Computertomographie
7.5 Fachbegriffe zum Thema lymphatisches System
8 Verdauungstrakt
8.1 Mundhöhle
8.1.1 Lippen
8.1.2 Zunge
8.1.3 Zahnfleisch und Mundschleimhaut
8.1.4 Zähne
8.1.4.1 Zahnaufbau
8.1.4.2 Zahnarten
8.1.4.3 Zahnwechsel
8.1.4.4 Zahnformel
8.1.5 Gaumen
8.1.5.1 Harter Gaumen
8.1.5.2 Weicher Gaumen
8.1.6 Rachen
8.1.7 Speicheldrüsen
8.1.7.1 Speichel
8.2 Vorgang des Kauens
8.3 Untersuchungsmethoden
8.3.1 Inspektion der Mundhöhle
8.3.2 Blutuntersuchung
8.3.3 Röntgen
8.4 Fachbegriffe zum Thema Kopfdarm
8.5 Rumpfdarm
8.5.1 Speiseröhre
8.5.2 Magen
8.5.2.1 Einhöhliger Magen
8.5.2.2 Zusammengesetzter Magen
8.5.2.2.1 Zweihöhliger Magen
8.5.2.2.2 Mehrhöhliger Magen
8.5.3 Darm
8.5.3.1 Dünndarm
8.5.3.1.1 Zwölffingerdarm
8.5.3.1.2 Leerdarm
8.5.3.1.3 Hüftdarm
8.5.3.1.4 Dünndarmschleimhaut
8.5.3.2 Dickdarm
8.5.3.2.1 Blinddarm
8.5.3.2.2 Grimmdarm
8.5.3.2.3 Mastdarm
8.5.3.2.4 Analkanal
8.5.3.2.5 Kloake
8.6 Physiologie der Verdauung
8.6.1 Speiseröhre
8.6.2 Kropf
8.6.3 Magen
8.6.3.1 Aufgaben des Magens
8.6.3.2 Magensaft
8.6.3.3 Magenbewegungen
8.6.3.4 Erbrechen
8.6.3.5 Funktion des Vogelmagens
8.6.4 Dünndarm
8.6.4.1 Drüsen des Dünndarms
8.6.4.2 Darmbewegungen
8.6.4.3 Darmflora
8.6.4.4 Verdauung im Dünndarm
8.6.5 Dickdarm
8.6.5.1 Aufgaben des Dickdarms
8.6.5.2 Dickdarmwand
8.6.5.3 Koprophagie und Caecotrophie
8.7 Untersuchungsmethoden
8.7.1 Leitsymptome
8.7.2 Röntgen und Ultraschall
8.7.3 Magen- und Darmspiegelung
8.7.4 Probelaparatomie
8.7.5 Laboruntersuchungen
8.7.5.1 Kotuntersuchungen
8.7.5.2 Blutuntersuchungen
8.8 Fachbegriffe zum Thema Rumpfdarm
8.9 Leber
8.9.1 Gallenwege und Gallenblase
8.9.1.1 Gallenfarbstoff
8.9.2 Aufgaben der Leber
8.9.2.1 Aufbau und Speicherfunktion
8.9.2.2 Entgiftung des Körpers
8.9.2.3 Drüsenfunktion
8.9.2.4 Abwehrfunktion
8.9.3 Untersuchungsmethoden
8.9.3.1 Körperliche Untersuchung
8.9.3.2 Röntgen und Ultraschall
8.9.3.3 Gewebeprobe (Biopsie)
8.9.3.4 Blutuntersuchung
8.9.4 Fachbegriffe zum Thema Leber
8.10 Bauchspeicheldrüse
8.10.1 Gestalt und Lage
8.10.2 Feinbau
8.10.3 Untersuchungsmethoden
8.10.3.1 Körperliche Untersuchung
8.10.3.2 Kotuntersuchung
8.10.3.3 Blutuntersuchung
8.10.3.4 Ultraschalluntersuchung
8.10.4 Fachbegriffe zum Thema Bauchspeicheldrüse
9 Endokrines System
9.1 Hormone
9.1.1 Hierarchie der Hormondrüsen
9.1.2 Hormon und Rezeptor
9.2 Zirbeldrüse
9.2.1 Untersuchungsmethoden
9.2.1.1 Computertomographie
9.3 Hypothalamus
9.3.1 Untersuchungsmethoden
9.3.1.1 Computertomographie
9.4 Hirnanhangdrüse
9.4.1 Hypophysenvorderlappen
9.4.2 Zwischenteil der Hypophyse
9.4.3 Hypophysenhinterlappen
9.4.4 Untersuchungsmethoden
9.4.5 Fachbegriffe zum Thema Hypophyse
9.5 Schilddrüse
9.5.1 Untersuchungsmethoden
9.5.1.1 Körperliche Untersuchung
9.5.1.2 Laboruntersuchungen
9.5.1.3 Ultraschalluntersuchung
9.5.1.4 Schilddrüsen – Szintigraphie
9.5.2 Fachbegriffe zum Thema Schilddrüse
9.6 Nebenschilddrüsen
9.6.1 Untersuchungsmethoden
9.6.1.1 Laboruntersuchungen
9.6.1.2 Röntgen
9.6.2 Fachbegriffe zum Thema Nebenschilddrüsen
9.7 Nebennieren
9.7.1 Nebennierenrinde
9.7.2 Nebennierenmark
9.7.3 Untersuchungsmethoden
9.7.4 Fachbegriffe zum Thema Nebennieren
9.8 Inselorgan der Bauchspeicheldrüse
9.8.1 Untersuchungsmethoden
9.8.1.1 Blutuntersuchung
9.8.1.2 Urinuntersuchung
9.8.2 Fachbegriffe zum Thema Inselorgan
9.9 Keimdrüsen
9.9.1 Funktion der Keimdrüsen
9.9.1.1 Kastration und Sterilisation
9.9.2 Hormone der Keimdrüsen
9.9.2.1 Östrogen
9.9.2.2 Progesteron
9.9.2.3 Testosteron
9.9.3 Untersuchungsmethoden
9.9.3.1 Laboruntersuchungen
9.9.4 Fachbegriffe zum Thema Keimdrüsen
10 Harnapparat
10.1 Harnbildende Organe
10.1.1 Nieren
10.2 Harnableitende Wege
10.2.1 Nierenbecken
10.2.2 Harnleiter
10.2.3 Harnblase
10.2.3.1 Inkontinenz
10.2.4 Harnröhre
10.3 Aufgaben des Harnapparate
10.3.1 Vorgang der Harnbereitung
10.3.1.1 Glomeruläre Filtration
10.3.1.2 Tubuläre Rückresorption
10.4 Untersuchungsmethoden
10.4.1 Körperliche Untersuchung
10.4.2 Laboruntersuchungen
10.4.2.1 Urinuntersuchung
10.4.2.2 Blutuntersuchung
10.4.2.3 Apparative Verfahren
10.5 Fachbegriffe zum Thema Harnapparat
11 Fortpflanzungsorgane
11.1 Weibliche Fortpflanzungsorgane
11.1.1 Eierstock
11.1.2 Eileiter
11.1.3 Gebärmutter
11.1.3.1 Uterushörner
11.1.3.2 Gebärmutterkörper
11.1.3.3 Gebärmutterhals
11.1.4 Scheide und Scheidenvorhof
11.1.5 Scham
11.1.5.1 Schamlippen
11.1.5.2 Kitzler
11.1.6 Vagina
11.1.7 Geschlechtsorgane des weiblichen Vogels
11.2 Männliche Fortpflanzungsorgane
11.2.1 Hoden
11.2.2 Hodensack
11.2.3 Nebenhoden
11.2.4 Samenleiter
11.2.5 Vorsteherdrüse
11.2.6 Männliches Glied
11.2.6.1 Vorhaut
11.2.7 Geschlechtsorgane des männlichen Vogels
11.2.7.1 Hoden des Vogels
11.2.7.2 Nebenhoden des Vogels
11.2.7.2 Samenleiter
11.2.7.3 Kopulationsorgan
11.3 Hoden und Eierstöcke als Hormondrüsen
11.3.1 Sexualzyklus des weiblichen Tieres
11.3.1.1 Proöstrus
11.3.1.2 Östrus
11.3.1.3 Metöstrus
11.3.1.4 Anöstrus
11.3.2 Sexualzyklen einzelner Tierarten
11.3.2.1 Sexualzyklus der Hündin
11.3.2.2 Sexualzyklus der Kätzin
11.3.2.3 Sexualzyklus des Meerschweinchen
11.3.2.4 Sexualzyklus des Kaninchens
11.3.2.5 Sexualzyklus von Kleinsäugern
11.4 Spermiogenese und Spermienreifung
11.4.1 Spermiogenese
11.4.2 Spermienreifung
11.5 Entwicklung des befruchteten Eies
11.5.1 Embryo und Fetus
11.6 Geburt
11.7 Laktation
11.8 Milchdrüse
11.9 Fertilität und Sterilität
11.10 Künstliche Besamung
11.11 Embryotransfer
11.12 Untersuchungsmethoden
11.12.1 Adspektion und Palpation
11.12.2 Röntgen und Ultraschall
11.12.3 Laboruntersuchungen
11.12.3.1 Allgemeine Blutuntersuchung
11.12.3.2 Spezielle Laboruntersuchungen
11.13 Fachbegriffe zum Thema Geschlechtsorgane
12 Haut und Hautanhangsgebilde
12.1 Haut
12.1.1 Unterhaut
12.1.2 Lederhaut
12.1.3 Oberhaut
12.2 Aufgaben der Haut
12.3 Hauterneuerung
12.4 Tast- Temperatur- und Schmerzsinn der Haut
12.5 Hautanhangsgebilde
12.5.1 Haare
12.5.1.1 Deckhaare
12.5.1.2 Wollhaare
12.5.1.3 Borstenhaare
12.5.1.4 Tasthaare
12.5.1.5 Aufbau eines Haares
12.5.1.6 Verankerung des Haares
12.5.1.7 Haardichte und Haarstrich
12.5.1.8 Haarwachstum
12.5.1.9 Haarwechsel
12.5.1.10 Haarfarbe
12.5.2 Federn
12.5.2.1 Deck- und Konturfedern
12.5.2.2 Flaumfedern (Daunenfedern, Dunenfedern)
12.5.2.3 Fadenfedern
12.5.2.4 Mauser
12.5.3 Krallen, Huf, Klaue
12.5.4 Spezifische Hautdrüsen
12.5.4.1 Zirkumoraldrüsen der Katze
12.5.4.2 Analbeuteldrüsen
12.5.4.3 Zirkumanaldrüsen des Hundes
12.5.4.4 Perinealdrüsen des Meerschweinchens und Kaninchens
12.5.4.5 Dorsales Schwanzorgan
12.5.4.6 Karpalorgan bei der Katze
12.5.4.7 Präputialdrüsen
12.5.4.8 Bauchdrüse bei Rennmäusen und Zwerghamstern
12.5.4.9 Flankendrüsen bei Hamstern
12.5.4.10 Ohrenschmalzdrüsen
12.5.4.11 Milchdrüse
12.5.4.12 Büreldrüse des Vogels
12.6 Untersuchungsmethoden
12.6.1 Adspektion
12.6.1.1 Effloreszenz
12.6.1.2 Juckreiz
12.6.1.3 Kahlheit
12.6.1.4 Unangenehmer Hautgeruch
12.6.1.5 Äußere Parasiten
12.6.2 Laboruntersuchugen der Haut
12.6.2.1 Hautgeschabsel
12.6.2.2 Hautbiopsie
12.6.2.3 Bakteriologische Untersuchung
12.6.2.4 Mykologische Untersuchung
12.7 Fachbegriffe zum Thema Haut und Hautanhangsgebilde
13 Immunsystem
13.1 Unspezifisches Immunsystem
13.1.1 Natürliche Barrieren des unspezifischen Immunsystems
13.1.1.1 Keimflora auf der Haut und den Schleimhäuten
13.1.1.2 Schleim
13.1.1.3 Flimmerhärchen
13.1.1.4 Tränen
13.1.1.5 Magensäure
13.1.1.6 Enzyme
13.1.1.7 Entleerungsfunktion
13.1.1.8 Körpertemperatur
13.1.2 Abwehrzellen des unspezifischen Abwehrsystems
13.1.2.1 Fresszellen
13.1.2.2 Natürliche Killerzellen
13.1.3 Humorale Anteile des unspezifischen Abwehrsystems
13.2 Spezifisches Immunsystem
13.2.1 Zelluläre Anteile des spezifischen Abwehrsystems
13.2.2 Humorale Anteile des spezifischen Abwehrsystems
13.3 Beeinflussung des Immunsystems
13.3.1 Einfluss der Psyche auf das Immunsystem
13.3.2 Therapeutische Beeinflussung des Immunsystems
13.3.2.1 Stimulation des unspezifischen Immunsystems
13.3.2.2 Stimulation des spezifischen Immunsystems
13.3.2.3 Maternale (mütterliche) Antikörper und passive Impfung
13.3.2.4 Unterdrückung des Immunsystems
13.4 Erkrankungen des Immunsystems
13.4.1 Allergie
13.4.1.1 Sensibilisierungsphase
13.4.1.2 Effektorphase
13.4.2 Autoimmun- und Autoaggressionserkrankungen
13.5 Untersuchungsmethoden
13.5.1 Blutuntersuchung
13.5.2 Haut- und Schleimhautbiopsie
13.5.3 Allergietest
13.5.4 Ausschließende Verfahren
13.6 Fachbegriffe zum Thema Immunsystem
14 Atmungsorgane
14.1 Obere Atemwege
14.1.1 Äußere Nase
14.1.2 Nasenhöhle
14.1.3 Nasennebenhöhlen
14.1.4 Nasenrachen
14.2 Untere Atemwege
14.2.1 Kehlkopf
14.2.1.1 Stimmapparat
14.2.1.2 Stimmkopf (Syrinx) bei Vögeln
14.2.3 Luftröhre
14.2.4 Lungen
14.2.4.1 Feinbau der Lungen
14.2.4.2 Surfactant
14.2.4.3 Vogellungen
14.3 Funktion der Atmungsorgane
14.3.1 Gasaustausch
14.3.2 Gastransport
14.4 Äußere und innere Atmung
14.5 Nasenatmung und Mundatmung
14.5.1 Nasenatmung
14.5.2 Mundatmung
14.6 Brustatmung und Bauchatmung
14.6.1 Brustatmung
14.6.2 Bauchatmung
14.6.3 Angestrengte Atmung
14.6.4 Atemfrequenz
14.6.5 Schnurren der Katze
14.6.6 Hecheln
14.5.7 Schnarchen
14.7 Nießen und Husten
14.7.1 Nießen
14.7.2 Husten
14.8 Untersuchungsmethoden
14.8.1 Adspektion
14.8.2 Auskultation
14.8.3 Perkussion
14.8.4 Ultraschall
14.8.5 Röntgen
14.8.6 Bronchoskopie
14.8.7 Lungenspülung
14.8.8 Punktion der Brusthöhle
14.9 Fachbegriffe zum Thema Atmungsorgane
15 Sinnesorgane
15.1 Sehorgan
15.1.1 Auge
15.1.1.1 Augenhäute
15.1.1.1.1 Äußere Augenhaut
15.1.1.1.2 Mittlere Augenhaut
15.1.1.1.3 Innere Augenhaut
15.1.1.2 Augenkammern
15.1.1.2.1 Vordere Augenkammer
15.1.1.2.2 Hintere Augenkammer
15.1.1.3 Kammerwasser
15.1.1.4 Linse
15.1.1.5 Glaskörper
15.1.1.6 Sehnerv
15.1.1.7 Tierartliche Besonderheiten
15.1.2 Hilfsorgane des Auges
15.1.2.1 Augenmuskeln
15.1.2.2 Augenlider
15.1.2.3 Drittes Augenlid
15.1.2.4 Bindehaut
15.1.2.5 Tränenapparat
15.1.2.6 Ableitende Tränenflüssigkeit
15.1.2.7 Tierartliche Besonderheiten
15.1.2.7.1 „Rote Tränen“
15.1.3 Sehvorgang
15.1.3.1 Farbensehen
15.1.3.2 Distanz- und Bewegungssehen
15.1.3.3. Gesichtsfeld
15.1.5 Untersuchungsmethoden
15.1.5.1 Augenhintergrundspiegelung
15.1.5.2 Augendruckmessung
15.1.5.3 Röntgen
15.1.5.4 Ultraschalluntersuchung
15.1.5.5 Schirmer-Test
15.1.5.6 Fluoreszin-Test
15.1.5.7 Pupillenreflexprüfung
15.1.5.8 Sehproben
15.1.6 Augennotfall „Grüner Star“
15.2 Ohr
15.2.1 Äußeres Ohr
15.2.1.1 Ohrmuschel
15.2.1.2 Äußerer Gehörgang
15.2.1.3 Trommelfell
15.2.2 Mittelohr
15.2.2.1 Paukenhöhle
15.2.2.2 Gehörknöchelchen
15.2.2.3 Ohrtrompete
15.2.3 Innenohr
15.2.3.1 Knöchernes Labyrinth (knöcherner Anteil des Innenohrs)
15.2.3.2 Häutiges Labyrinth (häutiger Anteil des Innenohrs)
15.2.3.3 Perilymphe und Endolymphe (flüssiger Anteil des Innenohrs)
15.2.4 Hörvorgang
15.2.5 Gleichgewichtsempfinden
15.2.6 Hörfrequenz
15.2.7 Lautstärke
15.2.8 Untersuchungsmethoden
15.2.8.1 Ohrspiegelung
15.2.8.2 Laboruntersuchungen
15.2.8.3 Prüfung der Hörfähigkeit
15.2.8.4 CT und MRT
15.3 Geruchsinn
15.3.1 Der Riechvorgang
15.3.1.1 Nutzen des Geruchssinns
15.3.1.2 Adaption
15.3.1.3 Pheromone
15.3.2 Untersuchungsmethoden
15.3.2.1 Riechprüfung
15.3.3 Ausgewählte Erkrankungen des Geruchssinns
15.3.3.1 Anosomie, Hyposomie, Parosomie
15.4 Geschmackssinn
15.4.1 Funktion des Geschmackssinns
15.4.2 Untersuchungsmethoden
15.5 Tastsinn
15.6 Zusätzliche Sinne
15.7 Fachbegriffe zum Thema Sinnesorgane
16 Nervensystem
16.1 Zentrales Nervensystem
16.1.1 Gehirn
16.1.1.1 Stammhirn
16.1.1.2 Kleinhirn
16.1.1.3 Zwischenhirn
16.1.1.4 Großhirn
16.1.1.5 Weitere Strukturen des Gehirns
16.1.1.5.1 Hirnhäute
16.1.1.5.2 Ventrikelsystem
16.1.1.5.3 Liquor
16.1.1.5.4 Blut-Hirn-Schranke
16.1.1.5.5 Blutgefäße des Gehirns
16.1.2 Rückenmark
16.2 Peripheres Nervensystem
16.2.1 Spinalnerven
16.2.2 Periphere Nerven
16.3 Willkürliches und unwillkürliches (vegetatives) Nervensystem
16.3.1 Willkürliches Nervensystem
16.3.2 Unwillkürliches Nervensystem
16.3.2.1 Sympathikus
16.3.2.2 Parasympathikus
16.4 Reflexe
16.4.1 Reflexbogen
16.5 Schmerz
16.5.1 Bedeutung des Schmerzes
16.5.2 Einteilung des Schmerzes
16.6 Untersuchungsmethoden
16.6.1 Neurologischer Untersuchungsgang
16.6.2 Weitere Untersuchungen
16.7 Fachbegriffe zum Thema Nervensystem
17 Service
Literaturverzeichnis
Wichtige Adressen
Bildquellen
Sachregister